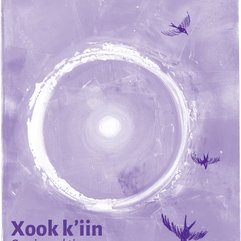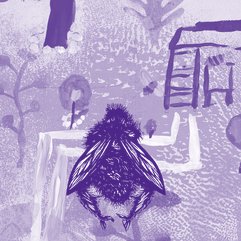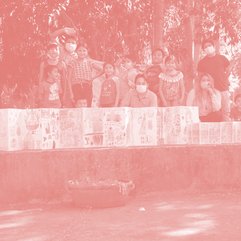Zeit zu reden Erinnerungskultur (2): Was bedeutet „Nie wieder ist jetzt“?
Eine kritische Diskussion über formelles Gedenken und multiperspektivisches Erkennen
19.00-22.30
Termin speichern
für Erwachsene
auf Deutsch

Wie kaum ein anderes Land ist Deutschland von seiner Erinnerungskultur geprägt. Die Lehren aus Nationalsozialismus und Holocaust haben die Entwicklung zu einer liberalen und demokratischen Gesellschaft entscheidend beeinflusst. In den Worten der Historikerin Elke Gryglewski wurde aus dem „Weltmeister im Genozid“ scheinbar ein „Weltmeister des Erinnerns“ – ein Land voller Gedenkstätten, Museen und Mahnmalen, mit Gedenktagen und Gedenkstunden im Bundestag. Und doch wissen die meisten Deutschen wenig über jüdisches Leben. Juden haben Angst, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen. Sinti und Roma werden rassistisch angefeindet. Und Politiker:innen begründen Gesetze oder Maßnahmen mit ausgrenzenden Parolen, die Ressentiments gegen Ausländer:innen, Muslim:innen, Geflüchtete, Palästinenser:innen und andere marginalisierte Gruppen schüren.
Was also läuft falsch am deutschen Erinnern? Was sind die Lehren aus dem Holocaust 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Welche Erinnerungskultur braucht Deutschland in Zeiten, in denen rechtsextremes und nationalistisches Denken erstarkt? Und was bedeutet der Satz "Nie wieder ist jetzt"? Uneingeschränkte Solidarität mit jüdischen Individuen, mit dem Staat Israel oder mit allen Menschen, die von Vernichtung bedroht ist – inklusive der Palästinenser:innen in Gaza?
Da die meisten Menschen in Deutschland keine persönliche Erinnerung an den Nationalsozialismus haben, muss aus dem Gedenken ein Lernen werden – nicht staatlich verordnet, sondern selbst erarbeitet.
Auf dem Panel diskutieren Expert:innen darüber, wie eine pluralistische, zukunftsorientierte Erinnerungskultur aussehen könnte. Sie verfolgen dabei einen multiperspektivischen Ansatz, der den Holocaust nicht nur aus deutscher Sicht und auf der Grundlage deutscher Abstammung betrachtet, sondern auch andere Erfahrungen mit Vertreibung, Verfolgung und Rassismus miteinbezieht, die zum historischen Bewusstsein beitragen können. Statt Syrer, Ukrainer, Vietnamesen, Türken und Palästinenser aufzufordern, dem Staat Israel die Treue zu schwören, hilft dieser Ansatz, sich wieder auf den Holocaust als singuläres Menschheitsverbrechen zu konzentrieren.
Was bedeutet das für Politik, Bildung und Zivilgesellschaft? Wie sieht eine Erinnerungskultur aus, die der spezifisch deutschen Verantwortung gerecht wird und dabei den allgemeingültigen Lehren aus dem Holocaust verpflichtet bleibt?
Teilnehmer*innen: Wolfgang Benz, Asal Dardan, Sarah El Bulbeisi und Gerhard Hanloser
Moderation: Kristin Helberg
Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Mercator statt.