Familiengeschichte von Hans W. Schöpflin
Spore wurde von dem Philanthropen und Unternehmer Hans W. Schöpflin gegründet. Mit der Gründung der Panta Rhea Foundation 1998 in den Vereinigten Staaten legte er den Grundstein für seine philanthropischen Aktivitäten, die einen Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt leisten sollen. In Kalifornien machte er sich als risikobereiter und innovativer Stifter einen Namen, als er eine erfolgreiche Kampagne gegen die Privatisierung eines Grundwasser-Reservoires in der Mojave-Wüste ermöglichte. In 2001 gründete er die Schöpflin Stiftung in Deutschland, die sich für die Stärkung kritischer Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft engagiert.

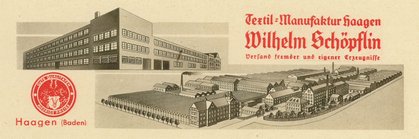 Textilmanufaktur Haagen
Textilmanufaktur HaagenAufgewachsen in den Nachkriegsjahren hat Hans W. Schöpflin die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland nicht selbst erlebt. Um Aufschluss über die Aktivitäten des ehemaligen Familienunternehmens "Versandhaus Schöpflin" (verkauft 1967), insbesondere während des zweiten Weltkriegs zu erhalten, hat die Familie gemeinsam mit der Schöpflin Stiftung im Frühjahr 2023 beschlossen, eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der Firmengeschichte mit besonderem Fokus auf die Zeit der NS-Herrschaft in Auftrag zu geben. Die Studie wird von der in Frankfurt ansässigen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte erarbeitet. Erste Ergebnisse liegen voraussichtlich zur Jahresmitte 2024 vor. Der fertige Bericht wird im Anschluss vollumfänglich veröffentlicht.
— August 2023
---
Update: Oktober 2025
Über historische Verantwortung und geerbte Privilegien
Die Schöpflin Stiftung, Schwesterorganisation der Spore Initiative, hat kürzlich die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) damit beauftragt, die Geschichte des Schöpflin-Versandhauses und der Unternehmerfamilie während der Zeit des Nationalsozialismus zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der Kurzstudie „Schöpflin im Dritten Reich“ veröffentlicht.
Der Schwerpunkt der Studie der Historikerin Dr. Andrea Schneider-Braunberger liegt auf den Gründern der Schöpflin-Textilmanufaktur in Haagen und des späteren Versandhandelsunternehmens: Wilhelm Schöpflin (1881–1952) und seiner Ehefrau Wilhelmine Schöpflin (1884–1975) sowie deren beiden Söhnen Hans Schöpflin (1906–1985) und Rudolf Schöpflin (1910–1978). Die Studie untersucht die politische Haltung der Familie, der das Unternehmen gehörte, und fragt, ob sie wirtschaftlich von der nationalsozialistischen Diktatur profitierte, sich an „Arisierungen“ beteiligte oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigte. Der in dieser Studie beschriebene und erwähnte Hans Schöpflin (1906–1985) war der Sohn von Wilhelm und Wilhelmine Schöpflin. Er ist nicht zu verwechseln mit Hans W. Schöpflin (geboren 1941), der später die Schöpflin Stiftung, Panta Rhea und die Spore Initiative mitbegründete.
Den vollständigen Text finden Sie auf der Website der Schöpflin Stiftung, ebenso weitere informationen über die Familie Schöpflin.
Bezug zur Spore Initiative
Die Spore Initiative wurde gegründet, um Arbeit an den Schnittstellen von ökosozialer Gerechtigkeit, ökologischer Regeneration und Bildung durch Kultur zu unterstützen – insbesondere innerhalb der Global Majority. Wir verstehen unsere Rolle als Ermöglicherin: Wir schaffen Bedingungen, damit langfristige, von Partnerinnen und Partnern getragene Praktiken entstehen, sich verankern und geteilt werden können.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat bestätigt, dass die Eltern und Großeltern des Gründers der Spore Initiative, Hans W. Schöpflin, Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei waren. Der Gründer selbst, geboren 1941, verließ Deutschland als junger Erwachsener und baute später in den Vereinigten Staaten eigenständig das Vermögen auf, das die Gründung der Spore Initiative ermöglichte. Dieses Vermögen steht nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Dennoch erkennen wir an, dass Strukturen von Privilegien und Zugang weit über finanzielle Erbschaften hinausreichen. Spore existiert innerhalb – und hat profitiert von – Systemen des rassistischen Kapitalismus und historischer Ungleichheit.
Spore bekräftigt die Bedeutung von Transparenz, historischem Bewusstsein und Verantwortungsübernahme im Umgang mit diesem Erbe. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Alternativen zu einer ausschließenden offiziellen Erinnerungskultur anzubieten. Für uns muss Erinnerungskultur sich nicht nur mit den sichtbarsten Täterinnen und Tätern oder den heroischen Widerstandskämpferinnen und -kämpfern auseinandersetzen, sondern auch mit der Mitverantwortung der bürgerlichen und unternehmerischen Schichten.
Spore steht eindeutig und beständig gegen alle Formen von Rassismus und Diskriminierung, einschließlich Antisemitismus. Wir nehmen die Erfahrungen derjenigen ernst, die am stärksten von faschistischer Gewalt betroffen waren und sind: jüdische Gemeinschaften, Roma und Sinti, Menschen mit Behinderungen, LGBTQI+-Personen, politische Verfolgte, Zivilpersonen aus besetzten Gebieten und andere. Ihre Leben und Vermächtnisse sind keine abstrakten Bezugspunkte, sondern bilden den Kern jeder ernsthaften Auseinandersetzung mit der Geschichte faschistischer Gewalt.
Wie Spore reagieren wird
Im Sinne von Dialog und Inklusivität wird Spore einen unabhängigen Beirat einrichten, der sich aus Personen mit Fachwissen und Erfahrung in den Bereichen Erinnerungsarbeit, historische Gewalt, politische Bildung und institutionelle Ethik zusammensetzt. Gemeinsam mit diesem Gremium werden wir mögliche ethische, politische und pädagogische Antworten auf die Auswirkungen dieses Erbes erarbeiten.
Diese Initiative steht für das Bekenntnis, einen notwendigen Dialog darüber zu beginnen, wie institutionelle Verantwortung heute aussehen kann. Unter der Begleitung des Beirats ist es unser Ziel, diesen Austausch in konkrete Maßnahmen zu überführen, die Spore’s langfristige Ausrichtung und Verantwortlichkeit prägen werden.
Dieser Prozess wird sich schrittweise entwickeln, parallel zu unserer laufenden Arbeit: der Unterstützung von Menschen und Organisationen, die an den Frontlinien ökologischer, kultureller und gemeinschaftsbasierter Veränderungen tätig sind. Wir werden die Überlegungen des Beirats sowie die daraus hervorgehenden Maßnahmen zu gegebener Zeit veröffentlichen.
Für Rückfragen: awareness@spore-initiative.org


